
BlueGreenStreets
Klimaanpassungsmaßnahmen für städtische Straßenräume
Im Rahmen des Projektes BlueGreenStreets werden Anpassungsmaßnahmen für städtische Straßenräume gegenüber dem Klimawandel untersucht. Im Fokus stehen dabei die Nutzung von Wasser und Grün.
Hintergrund
Die hohe Wohnraumnachfrage führt in vielen Städten zu Bauaktivitäten und damit zu einem Rückgang von grünen Freiflächen. Der hiermit verbundene hohe Versiegelungsgrad und der voranschreitende Klimawandel führen in Städten zunehmend zu Problemen. Gebäude und versiegelte Flächen nehmen Wärme auf, speichern diese und führen so an den vermehrt auftretenden heißen Sommertagen zu Hitzestress bei der städtischen Bevölkerung. Gesundheitliche Probleme können die Folge sein. Neben der Zunahme von Hitzetagen treten, bedingt durch den Klimawandel, auch vermehrt konvektive Starkregenereignisse auf. Dabei werden große Mengen des Niederschlagswassers aufgrund des hohen Versiegelungsgrades in Städten zum Abfluss gebracht. Da die städtischen Entwässerungsinfrastrukturen nicht für seltene Starkregenereignisse ausgelegt sind, kommt es hierdurch zu Überflutungen. Diese können mit erheblichen Schäden an Gebäuden und städtischer Infrastruktur einhergehen.

Zielstellung
Im Forschungsprojekt BlueGreenStreets soll untersucht werden, wie Straßenräume zukunftsfähig gestaltet werden können. Entscheidend ist dabei die Frage, wie sie gestaltet sein müssen, damit sie zu einer klimagerechten Stadt beitragen. Die Nutzung von Niederschlagswasser und Stadtgrün im Straßenraum soll die Lebensqualität und das Mikroklima von Stadtquartieren verbessern. Daneben gilt es durch eine multifunktionale Gestaltung städtischer Straßenräume die Gefahr von Schäden durch Starkregenereignisse zu verringern. Berücksichtigt werden müssen hierzu die Wechselwirkungen der unterschiedlichen Nutzungsinteressen, vor allem der Siedlungswasserwirtschaft, der Landschaftsplanung und der Verkehrsplanung.
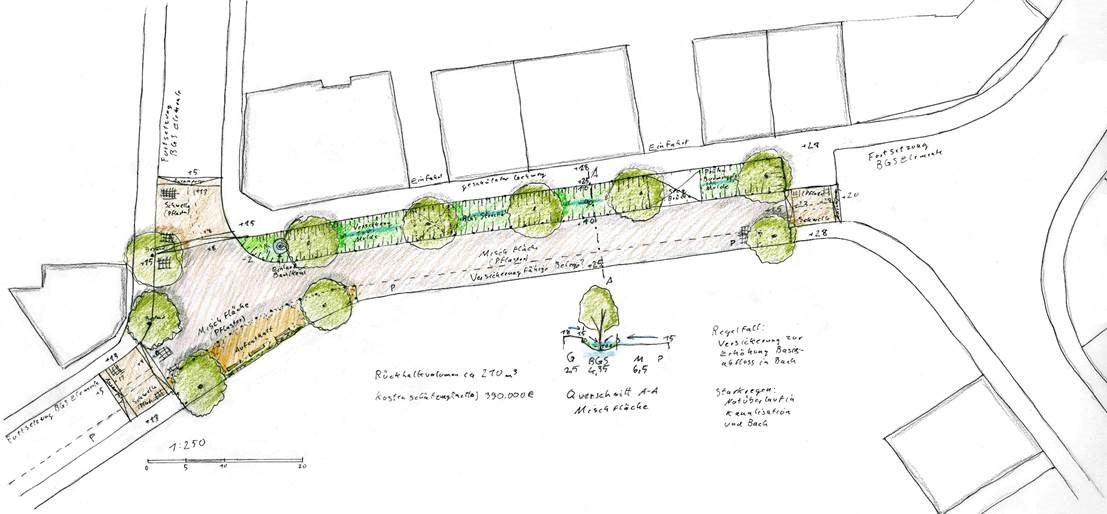
Methode
Das Forschungsprojekt gliedert sich in drei Bereiche:
- Vertiefende Forschung in den Fachbereichen
- Integration von Praxis und Forschung
- Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit
Dabei findet eine enge Verknüpfung von Forschung und Praxis statt. In ausgewählten Modellkommunen werden die Planungswerkzeuge und der Umsetzungsprozess für eine multifunktionale Gestaltung des Straßenraums untersucht. Hierzu werden in den Modellkommunen in Zusammenarbeit mit den dortigen Fachabteilungen Pilotprojekte durchgeführt. Insgesamt werden folgende Fachmodule bearbeitet:

Modul 1.1: Statusanalyse
Literaturanalyse & Experteninterviews zur Darstellung bisheriger Erfahrungen und Rahmenbedingungen

Modul 1.2: Vitalisierung technischer Lebensräume
Planung, Bau und Monitoring von Baumrigolen
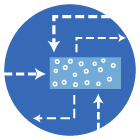
Modul 1.3: Elemente der Wasserspeicherung
Bewertung von blauen Elementen anhand von Entwurf, Planung, Modellierung und Monitoring von Pilotstandorten

Modul 1.4: Evapotranspirationsleistung
Durch Lysimetermessungen werden Aussagen zur Evapotranspirationsleistung von Stadtbäumen und Fassadengrün abgeleitet
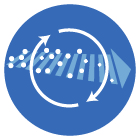
Modul 1.5: Stoffstrommanagement
Modellierung zur Hotspot-Analyse & In-situ-Messungen von Straßenabflüssen

Modul 1.6: Integriertes Sanierungsmanagement
Entwicklung und Test von Modellen und Algorithmen, um wirtschaftliche und inhaltliche Synergien zu bewerten

Modul 1.7: Mikroklimatische Auswirkungen
Mikroklimatische Simulationen von Straßenraumentwürfen

Modul 2.1: Entwurfswerkstatt
Zusammenführung aller Erkenntnisse und realer Entwurfssituationen ("research by design")

Modul 2.2: Erweiterte ökonomische Bewertung
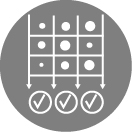
Modul 2.3: Bewertungs- und Nachweistool
3D-Projektionen und modelltechnische Bewertung realer Straßenraumentwürfe

Modul 2.4: Integratives und transdisziplinäres Querschnittsprojekt
Integration der Ergebnisse in Governanceprozesse und Planungsverfahren

Modul 2.5: Multicodierter Straßenraumentwurf - BGS-Toolbox
Entwurfsbasierte, begleitende Forschung zur Entwicklung multicodierter Straßenräume
Das Institut für Verkehr und Infrastruktur ist schwerpunktmäßig an den Modulen 1.3 (Elemente der Wasserspeicherung), 1.5 (Stoffstrommanagement), 1.6 (integriertes Sanierungsmanagement) und 2.5 (Multicodierter Straßenraumentwurf - BGS-Toolbox) beteiligt.
Projektlaufzeit
März 2019 bis Februar 2022
Projektpartner
HafenCity Universität Hamburg (HCU)
Universität Hamburg, Institut für Bodenkunde
bgmr Landschaftsarchitekten GmbH, Berlin
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker, Hoppegarten
IÖW - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Berlin
GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Hannover
Technische Universität Berlin, ARGE Ökohydrologie und Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft
Kommunale Partner
Berlin: Berliner Wasserbetriebe; Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK)
Bochum
Bremen
Hamburg: Behörde für Umwelt und Energie (BUE); Bezirksamt Altona; Bezirksamt Eimsbüttel; Bezirksamt Harburg; Landesbetrieb Brücken, Straßen und Gewässer (LSBG)
Neuenhagen bei Berlin: Bauamt
Solingen: Technische Betriebe
Gefördert durch
